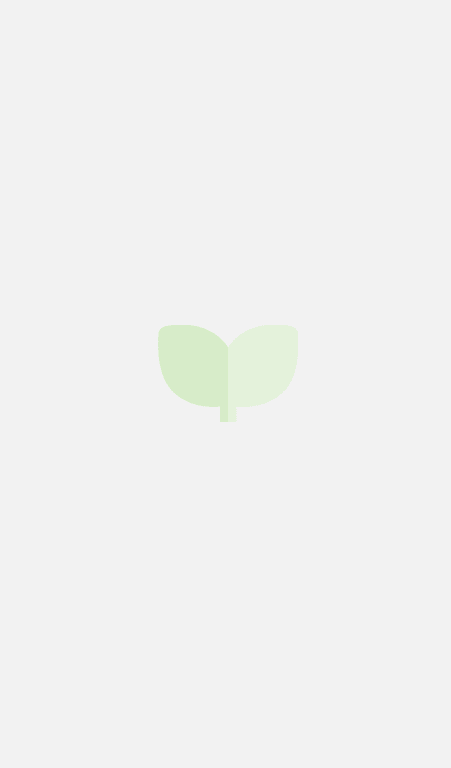Löwenzahn
Taraxacum off.Leberheilpflanze (Leberentzündung, Leberverhärtung, "Leberstau") und den daraus resultierenden Beschwerden
Sinnesorgane
Der Name “taraxis” = Auge, deutet schon auf eine Indikation:
- heilt rote, geschwollene, entzündete Augen
hier am besten als Kaltauszug – lau abwaschen
Neurologie / Gehirn
- Schlaflosigkeit, wenn diese zur “Leberzeit” 1 – 3 Uhr auftritt
- Taraxacum Patienten schwitzen leicht beim Einschlafen
- Kopfschmerz mit bitterem Geschmack im Mund (Furlenmeier)
Innere Medizin
Cholin wirkt gegen Leberschäden:
- Fettleber
- “Leberstau”, Leberverhärtung und in Folge bei
- Pfortaderstau
Wirkt auch choleretisch (galleflußfördernd), dadurch wird die
- Darmperistaltik aktiviert: der Stuhl wird weicher
- unterstützt die Fettverdauung
- Gallensteinbildung wird reduziert
Inulin (besonders im Herbst als Reservestoff von der Pflanze eingelagert):
- dringt besonders leicht in das Interstitium ein, nicht in die Zelle, dadurch wird der Blutzuckerspiegel nicht beeinflusst
- Kalium:
- nötig zur Regulierung des Wasserhaushaltes und der Muskeltätigkeit
TCM:
- ” leitet Feuchtigkeitsstagnation aus Leber und Niere, leitet feuchte Hitze aus”
- trübe Flüssigkeiten im Körper die als Schleim ausfällen, dadurch das Fließen der Körperflüssigkeiten behindern, worauf sich Hitze aufbaut
Zielorgan des Löwenzahns ist der Leberstoffwechsel (Metalloproteinasen):
- bei toxischen Leberschäden jeder Art
- bei Folgen nach akuter oder subakuter Leberaffektion
- nach Hepatitis (hemmt TNT-a, PGE2 senkend: antiphlogistisch)
- hepatoprotektiv, besonders bei schon geschädigter Leber
- antiproliverativ
Symptome die auf dies Mittel verweisen:
- Landkartenzunge
- “Die Zunge ist von einem weißlichen Film bedeckt, der sich rau anfühlt und in Fetzen löst, rote, empfindliche Flecken zurücklassend” (Boericke)
- Zungenbelag weiß oder gelb, nur schwach ausgeprägt mit auffälliger Abschürfung am Zungenkörper (M. Wood)
- gelbe Haut, Gelbsucht
- bitterer Mundgeschmack, Übelkeit, Appetitlosigkeit
- Aufstoßen, Völlegefühl, Fettunverträglichkeit
- entfettend/Fettsucht, Hüftspeck ist Zeichen von Leberschwäche; kurweise 1 Monat anwenden (Madejsky M)
- Kopfschmerzen mit Hitzegefühl am Scheitel, Tinnitus und kalten Fingerspitzen
- Schmerz des Sternokleidomastoideus
- Druckempfindlichkeit der Leber
- Metabolisches Syndrom
- Schwangerschaftsdiabetes, bes. bei Frauen mit kräftiger Statur
- Bluthochdruck durch “Leber- (Chi-) Stau”
- Hepatis A und B: Taraxacum D4
Insgesamt zeigt der Löwenzahnexrakt eine leistungssteigernde und erschöpfungswidrige Wirkung (Tierversuch); wobei ein verzögerter Blutglukoseabfall bei gleichzeitig verzögertem Anstieg der Triglyzerid- und Laktasewerte festgestellt wurde
Urologie
Anregung der Diurese
- bei Wassersucht, aber nur wenn diese durch eine Leberbelastung bedingt ist
Aquarese : mehr als bei anderen Pflanzen
- günstig bei Nierengrieß und unterstützend bei Harnwegsinfekten
Endokrinologie
Bei hormonellen Störungen die von der Leberfunktion beeinträchtigt werden, z. B.:
- PMS, Dysmenorrhoe, Gereiztheit
- schmerzhafte Entzündung der Prostata und Blase
- “Universalreiniger der Bauchorgane und eignet sich vor allem für Frauen, die zu reichhaltig essen und unter Pestizidbelastung leiden” (Madejsky M)
Haut
Durch Anregung des Stoffwechsels:
- bei unreiner Gesichtshaut
- bei Neurodermitis nach Impfung
- bei Juckreiz und Ekzem, wenn leberbedingt
- Warzen (TEN)
TCM: “bei aufsteigendem Leber-Yang”, zur Haut steigende Hitze
- “Feuergift”: Abszesse, Eiterbeulen, Geschwüre
Orthopädie / Rheumatologie
Durch Stoffwechselanregung auch interstitiell bei:
- Arthrose und
- chron. rheumatischen Beschwerden einzusetzen, auch präventiv
- Fibromyalgie, therapiebegleitend
Homöopathisch bei Schmerzen in der linken Hüfte und im linken Knie (bes. Meniskusbeschwerden), hat sich in D4 bewährt
Immunologie / Allergologie
- Zur Amalgamsanierung und bei Bleibelastung, durch Leberstärkung nützlich
- immunmodulierend
- Infektion der Nebenhöhlen, Sinusitis, welche sich auf die umgebenden Knochen ausbreitet, auch auf die Augen und Ohren und das Mastoid
- Infektion der Zahnwurzeln
- regt das darmassoziierte Immunsystem an (Madejsky M)
- Allergie (M. Wood)
- bei chronischem Müdigkeitssyndrom
- hemmt das Größenwachstum und die Invasivität von Prostata- und Brustkrebszellen
- apoptosefördernde Wirkung bei Leberkarzinom-, Leukämie- und Pankreaskarzinomzellen
- 100 g Löwenzahnblätter enthalten durchschnittlich 60 00 IE Carotin (Antioxidans)
Psyche
Reizbarkeit bei Leberpatienten
- bei Ärger und Bitterkeit, gehässig
- aber auch Stumpfheit
Gibt Energie in Phasen des Abschieds, der Neuorientierung und bei Lebenskrisen
Dosierung / Anwendungsform
Zubereitung:
1 TL Droge mit 1 Tasse heißem Wasser aufgießen, 5 – 10 Min ziehen lassen, 3 – 5 Tassen tgl.; 4 Wochen lang trinken
Auch Saft und Tinkturen sind möglich
Lymphdiaral-Basistropfen enthalten Löwenzahn
Der Löwenzahn muß u.U. monatelang eingenommen werden um die Leber zu regenerieren
Nebenwirkung / Kontraindikation
Gegenanzeigen:
- Verschluss der Gallenwege, Gallenblasenempyem, Ileus
Weitere Pflanzen aus dem Fachgebiet: Arthrosemittel
Kohl
Entzündungshemmend, antioxidativ
Hauhechel
Harntreibend, vermehrt die Harnsäureausscheidung
Rosskastanie, Samen
Venentonisierend, abdichtend, bei venöser Stase und Ödemen
Die Seite befindet sich im Aufbau und die Angaben können teilweise noch nicht vollständig sein. Die Inhalte dienen ausschließlich der Erstinformation der Nutzer. Die Inhalte können keine fachmedizinische Diagnose und/oder Behandlung durch einen Arzt ersetzen.